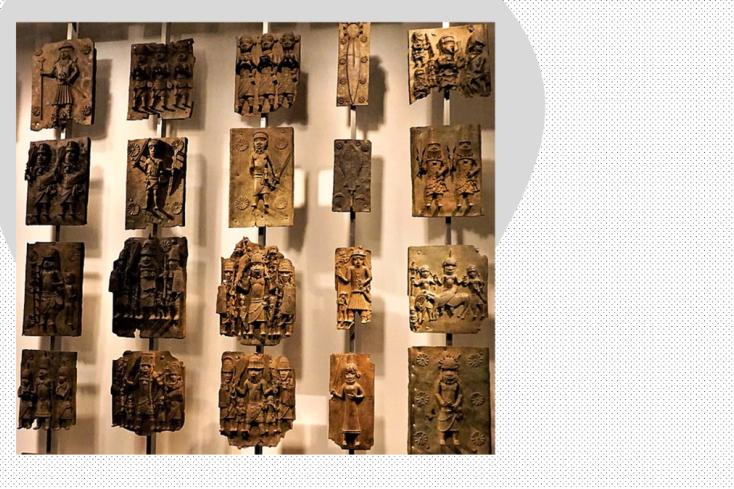Projekte und Kooperationen
Primary tabs
Das Arnold-Bergstraesser-Institut (ABI) wirbt regelmäßig Drittmittel für wissenschaftliche Forschungsprojekte sowie für angewandte Projekte ein. Neben etablierten Forschungsförderinstitutionen wie etwa DFG, DSF oder Fritz-Thyssen-Stiftung arbeitet das ABI auch projektbezogen mit Ministerien, politischen Stiftungen, dem DAAD oder Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit zusammen. Viele Projekte finden dabei in enger Kooperation mit Partnern im In- und Ausland statt.